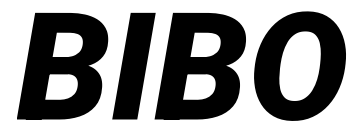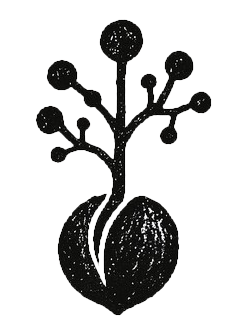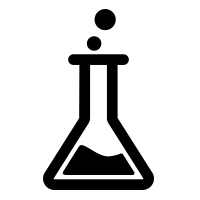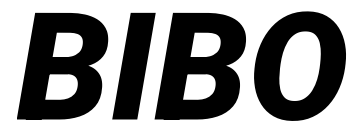Aesthetics of the Common
„Aesthetics of the Common“ erforscht, wie kollaborative und offene Praktiken in der digitalen Welt neue ästhetische Formen schaffen. Die Autor:innen zeigen, wie Projekte wie Wikipedia oder Open-Source-Kunst gemeinsame Werte und Alternativen zum kommerziellen Kulturbetrieb entwickeln. Das Buch verbindet Kunst, Technologie und Aktivismus – etwa in Projekten, die Urheberrecht oder Überwachung thematisieren. Es geht um die Frage, wie Technologien wie Blockchain oder dezentrale Netzwerke nicht nur Werkzeuge, sondern auch ästhetische Prinzipien prägen. „Aesthetics of the Common“ fordert dazu auf, Kultur als gemeinsame Ressource zu verstehen und aktiv an ihrer Gestaltung teilzuhaben.
In „Aesthetics of the Common“ untersuchen Shusha Niederberger, Cornelia Sollfrank und Felix Stalder, wie sich ästhetische Praktiken im Kontext digitaler Gemeingüter (Commons) entwickeln. Das Buch verbindet kunsttheoretische, medienwissenschaftliche und politische Perspektiven, um zu zeigen, wie kollaborative und offene Praktiken neue Formen des kulturellen Schaffens hervorbringen. Die Autor:innen argumentieren, dass die Ästhetik des Gemeinsamen nicht nur eine Frage des Stils ist, sondern auch eine politische Haltung gegenüber Eigentum, Autorschaft und Teilhabe in der digitalen Sphäre.
Commons als kulturelle Praxis Ein zentrales Thema des Buches ist die Idee der Commons (Gemeingüter) als Grundlage für neue ästhetische Strategien. Die Autor:innen zeigen, wie digitale Plattformen, Open-Source-Tools und kollaborative Netzwerke Räume schaffen, in denen künstlerische und kulturelle Produktion jenseits traditioneller Marktlogiken stattfinden kann. Dabei wird die Ästhetik des Gemeinsamen als eine Praxis verstanden, die auf Teilen, Kooperation und kollektiver Autorschaft basiert.
Beispiele wie Wikipedia, Creative Commons oder kollaborative Kunstprojekte verdeutlichen, wie diese Praktiken nicht nur Inhalte produzieren, sondern auch neue ästhetische Formen und Werte schaffen. Die Autor:innen betonen, dass solche Projekte oft eine kritische Haltung gegenüber kommerziellen Verwertungslogiken einnehmen und alternative Modelle des kulturellen Austauschs entwickeln.
Kunst und Aktivismus im digitalen Raum Ein weiterer Schwerpunkt des Buches ist die Verbindung von künstlerischen und aktivistischen Praktiken in digitalen Commons. Die Autor:innen analysieren Projekte, die sich mit Themen wie Urheberrecht, Überwachung und digitaler Souveränität auseinandersetzen. Dabei zeigen sie, wie künstlerische Interventionen – etwa durch Hackathons, digitale Zirkulation von Wissen oder subversive Nutzung von Plattformen – politische Diskurse prägen können.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Arbeit von Cornelia Sollfrank, die mit Projekten wie „Creating Commons“ die Schnittstelle zwischen Kunst, Technologie und politischem Aktivismus erforscht. Solche Projekte demonstrieren, wie die Ästhetik des Gemeinsamen genutzt werden kann, um hegemoniale Strukturen in Frage zu stellen und emanzipatorische Räume zu schaffen.
Technologie und Ästhetik Das Buch untersucht auch die Rolle von Technologie in der Entwicklung einer Ästhetik des Gemeinsamen. Die Autor:innen diskutieren, wie Open-Source-Software, Blockchain oder dezentrale Netzwerke nicht nur Werkzeuge, sondern auch ästhetische Prinzipien prägen. Dabei wird Technologie nicht als neutral betrachtet, sondern als ein Feld, in dem soziale und politische Konflikte ausgetragen werden.
Beispiele wie die Nutzung von Git für kollaborative Kunstprojekte oder die Ästhetik von Datenvisualisierungen in aktivistischen Kontexten zeigen, wie technologische Infrastrukturen ästhetische Ausdrucksformen beeinflussen. Die Autor:innen plädieren für eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Technologien, um ihre emanzipatorischen Potenziale zu nutzen.
Eine neue Ästhetik der Kollektivität „Aesthetics of the Common“ ist ein Plädoyer für die Anerkennung und Weiterentwicklung ästhetischer Praktiken, die auf Gemeingütern basieren. Niederberger, Sollfrank und Stalder zeigen, dass diese Ästhetik nicht nur eine formale Qualität besitzt, sondern auch eine politische Dimension: Sie steht für eine Kultur des Teilens, der Offenheit und der kollektiven Selbstbestimmung.
Das Buch fordert dazu auf, die Ästhetik des Gemeinsamen als integralen Bestandteil einer kritischen digitalen Kultur zu verstehen und aktiv zu gestalten. Es ist eine Einladung, die Potenziale kollaborativer Praktiken jenseits von kommerziellen und staatlichen Kontrollmechanismen zu erkunden.
QUELLE / ISBN - 978-3035803457
--> Deutsche Nationalbibliothek--> WorldCat
--> Open Libary