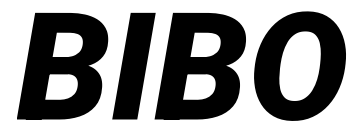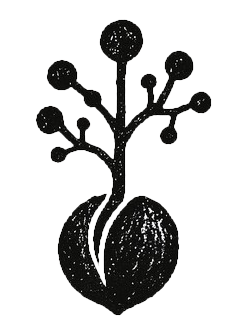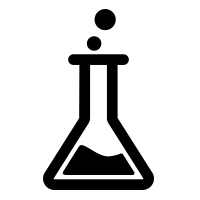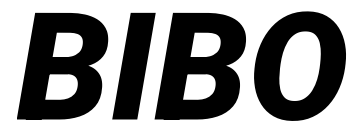Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need
In „Design Justice“ untersucht Sasha Costanza-Chock, wie Designprozesse oft bestehende Machtverhältnisse reproduzieren und wie alternative, von der Community geleitete Gestaltungsansätze gerechtere Zukünfte ermöglichen können. Das Buch basiert auf eigenen Erfahrungen, Fallstudien und Netzwerken wie dem Design Justice Network und entwickelt eine tiefgreifende Kritik an inklusionsfernen Designpraktiken sowie eine Vision für gerechtes, kollektives Design.
Sasha Costanza-Chock analysiert in „Design Justice“ die systemischen Ungleichheiten, die in Designprozessen eingeschrieben sind. Design sei niemals neutral, sondern stets Ausdruck sozialer, ökonomischer und politischer Strukturen. Sie beschreibt, wie marginalisierte Gruppen — insbesondere Schwarze Menschen, Indigene, People of Color, trans, nichtbinäre und behinderte Menschen — regelmäßig von Designlösungen ausgeschlossen werden oder sogar Schaden erfahren, wenn diese nicht auf ihre Lebensrealitäten abgestimmt sind. Die Autor*in führt zahlreiche konkrete Beispiele an, etwa automatisierte Seifenspender, die dunklere Hauttöne nicht erkennen, oder Wahlmaschinen, die für Nutzer\innen mit körperlicher Einschränkung nicht zugänglich sind.
Ein zentraler Begriff des Buches ist „Design Justice“, verstanden als Praxis, die nicht nur auf die gerechte Verteilung von Zugängen, sondern auch auf die gerechte Verteilung von Gestaltungsmacht zielt. Die Autor*in betont, dass es nicht ausreicht, marginalisierte Gruppen in bestehende Systeme zu integrieren. Vielmehr müssen diese Gruppen selbst die Designprozesse leiten, da sie das nötige Erfahrungswissen besitzen, um wirklich transformative Lösungen zu entwickeln. Diese Sichtweise wird mit dem Motto des Design Justice Network „Nothing about us without us“ verbunden.
Aus der Perspektive der Disability Justice, der Critical Race Theory und dekolonialer Theorie zeigt Costanza-Chock auf, dass viele technologische Systeme in einer Logik entwickelt wurden, die dominante Normen als universell setzt — weiße, westliche, cis-heteronormative, männliche Perspektiven. Sie beschreibt, wie partizipative Prozesse scheitern können, wenn sie lediglich als symbolische Geste gedacht sind, ohne tatsächlich Macht zu teilen. Als Gegenmodell entwickelt sie ein Framework, das auf dem Wissen und der Führung betroffener Communities basiert, wie zum Beispiel bei der Entwicklung von Community Wireless Networks oder kollaborativen urbanen Designprozessen in Boston und Detroit.
Ein wiederkehrendes Thema ist die Kritik an der Ideologie des Solutionismus, die davon ausgeht, dass jedes gesellschaftliche Problem mit Technologie gelöst werden könne. Costanza-Chock stellt dem die Notwendigkeit von Care-zentrierten, gemeinschaftsgetriebenen und prozessorientierten Designformen entgegen. Technologie wird nicht als isoliertes Produkt gedacht, sondern als eingebettet in soziale Praktiken und Beziehungen. Dabei wird der Begriff der „Pluriversality“ eingeführt — ein Pluralismus von Weltentwürfen, in denen viele gleichberechtigte Perspektiven existieren.
Die Autor*in reflektiert auch die eigene Rolle als nicht-binäre, weiße, trans* Person innerhalb dieser Prozesse und diskutiert die Herausforderung, privilegierte Positionen kritisch zu hinterfragen, ohne in paternalistische Haltung zu verfallen. Besonders eindrücklich ist die Schilderung eines Hackathons, bei dem versucht wurde, eine App gegen rassistische Polizeigewalt zu entwickeln, ohne die betroffenen Communitys überhaupt einzubeziehen — ein Beispiel für technologische Arroganz, die an realen Bedürfnissen vorbeigeht.
Design Justice ist also keine Methode, sondern eine Praxis, ein politisches und ethisches Projekt. Es geht darum, Räume, Infrastrukturen, digitale Technologien und Kommunikationsmittel nicht für, sondern mit denjenigen zu gestalten, die am stärksten von Diskriminierung betroffen sind — und diesen Gruppen die Gestaltungsmacht zu überlassen. Costanza-Chock macht deutlich, dass gerechtes Design nicht auf technischer Ebene beginnt, sondern mit Beziehungen, mit Zuhören, mit Vertrauen und mit einer radikal anderen Vorstellung davon, wie Veränderung entsteht.
QUELLE / ISBN - 978-0-262-53890-2
--> Deutsche Nationalbibliothek--> WorldCat
--> Open Libary