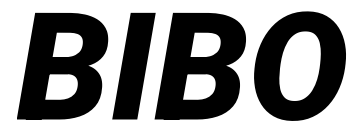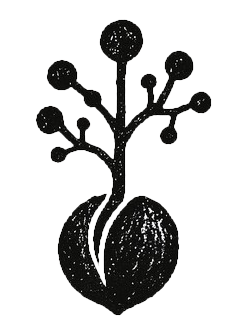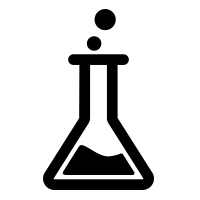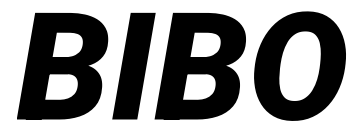Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence
Andy Clark argumentiert in Natural-Born Cyborgs, dass Menschen von Natur aus dazu geschaffen sind, technologische Erweiterungen in ihren kognitiven Prozess zu integrieren. Das Buch stellt die These auf, dass unser Geist nicht auf das Gehirn beschränkt ist, sondern sich ständig durch Werkzeuge, Geräte und kulturelle Praktiken erweitert – wir sind von Anfang an kybernetische Wesen.
Andy Clarks Natural-Born Cyborgs entfaltet eine zentrale These: Der menschliche Geist ist nicht abgeschlossen im Schädel, sondern ein „extended mind“, der sich durch Technologie, Sprache und soziale Praktiken erweitert. Clark geht davon aus, dass der Mensch von Beginn an als ein Wesen gedacht werden muss, das auf symbiotische Weise mit seinen Werkzeugen lebt – nicht als Ausnahmezustand, sondern als biologische Norm.
Er beginnt mit einer kritischen Analyse klassischer kognitionswissenschaftlicher Modelle, die den Geist als rein intern auffassen. Dagegen argumentiert er, dass Technologien wie Notizbücher, Taschenrechner, Smartphones oder auch Schrift und Sprache integrale Bestandteile unseres Denkens sind. Sie sind keine bloßen Hilfsmittel, sondern tief eingebettet in die Art, wie wir erinnern, lernen, planen oder kommunizieren.
Ein zentrales Beispiel ist der sogenannte „Otto-Fall“ (aus einem verwandten Aufsatz von Clark & Chalmers), in dem ein Mann mit Alzheimer ein Notizbuch verwendet, um Informationen über seinen Alltag zu speichern. Clark zeigt, dass Ottos Notizbuch eine funktionale Erweiterung seines Gedächtnisses ist – es erfüllt die gleiche Rolle wie ein biologisches Gedächtnis bei anderen Menschen. Damit stellt sich die Frage, ob unser Geist tatsächlich dort endet, wo unsere Haut aufhört.
Das Buch verbindet Philosophie des Geistes, Neurowissenschaften, Anthropologie und Technikphilosophie, um zu zeigen, dass technologische Erweiterung nicht etwas ist, das „zu uns“ kommt, sondern etwas, das „wir sind“. Clark diskutiert die Entwicklung tragbarer Computer, Gehirn-Computer-Schnittstellen und andere kybernetische Technologien als logische Fortsetzung einer uralten Tendenz: Werkzeuge und Systeme zu schaffen, die Denken und Handeln verschmelzen lassen.
Besonders überzeugend ist Clarks Analyse der Alltagskognition. Er zeigt, dass selbst triviale kognitive Aufgaben – etwa das Navigieren in einer Stadt oder das Kochen eines komplexen Rezepts – auf externe Hilfsmittel angewiesen sind. Diese „scaffolds“ (Gerüste) erweitern unser Arbeitsgedächtnis, reduzieren kognitive Last und ermöglichen es uns, komplexe Handlungen effizient durchzuführen.
Ein weiteres zentrales Motiv ist die Rolle des Körpers in dieser erweiterten Kognition: Clark betont, dass Embodiment – also das körperlich-sensorische Eingebundensein – entscheidend dafür ist, wie Technologien integriert werden. Unser Verhältnis zu Technologie ist nicht nur funktional, sondern auch körperlich, affektiv und habituell verankert.
Am Ende plädiert Clark dafür, den Menschen nicht mehr als rein biologisches Wesen zu denken, sondern als techno-organisches Hybridwesen – ein „natural-born cyborg“, der seine Intelligenz von jeher über Grenzen hinweg entfaltet. Diese Sichtweise hat tiefgreifende Implikationen für Bildung, Ethik, Design und das Verständnis von Identität im technologischen Zeitalter.
Das Buch ist kein Plädoyer für technologische Utopien, sondern eine Einladung, unsere Beziehung zu Werkzeugen und Technologien neu zu denken – nicht als äußere Hilfen, sondern als integrale Bestandteile unseres Denkens und Seins.
QUELLE / ISBN - 978-0195177510
--> Deutsche Nationalbibliothek--> WorldCat
--> Open Libary