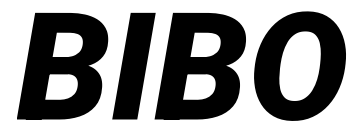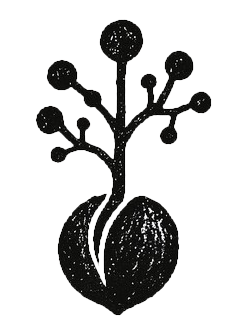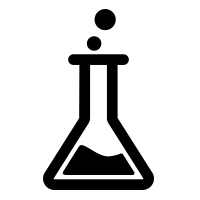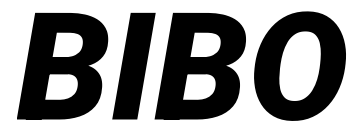Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming
In „Speculative Everything“ zeigen Anthony Dunne und Fiona Raby, wie Design genutzt werden kann, um über die Zukunft nachzudenken. Sie nennen das „spekulatives Design“. Dabei werden fiktive Objekte und Welten entworfen, die Fragen über unsere Gesellschaft stellen. Zum Beispiel: Wie werden wir in Zukunft essen, wenn das Klima sich ändert? Oder wie könnten neue Technologien unser Leben beeinflussen? Das Buch ist voller Beispiele, wie Designer:innen solche Fragen erforschen. Es geht nicht darum, Lösungen zu finden, sondern Diskussionen anzuregen. Dunne und Raby wollen, dass Design nicht nur praktisch, sondern auch kritisch und politisch ist. Es ist ein Aufruf, die Welt neu zu denken.
Einleitung: Design als Werkzeug für gesellschaftliche Visionen In „Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming“ entwerfen Anthony Dunne und Fiona Raby eine radikale Neudefinition von Design. Sie fordern dazu auf, Design nicht länger nur als Mittel zur Problemlösung oder zur Schaffung von Produkten zu verstehen, sondern als kreatives Instrument, um gesellschaftliche Diskussionen anzuregen und neue Zukunftsvisionen zu entwerfen. Das Buch plädiert dafür, Design als eine Form des „sozialen Träumens“ zu nutzen, das uns dazu anregt, über unser Zusammenleben, unsere Werte und unsere Zukunft nachzudenken. Dabei geht es nicht darum, konkrete Lösungen zu präsentieren, sondern provokative Szenarien zu schaffen, die zum Nachdenken und Umdenken anregen.
Hintergrund: Vom Critical Design zum Spekulativen Design Anthony Dunne und Fiona Raby sind bekannte Figuren in der Designwelt, die sich bereits mit ihrem Konzept des „Critical Design“ einen Namen gemacht haben. In „Speculative Everything“ gehen sie noch einen Schritt weiter und entwickeln das Konzept des „Spekulativen Designs“. Während Critical Design darauf abzielt, bestehende Normen und Praktiken zu hinterfragen, zielt spekulatives Design darauf ab, völlig neue Möglichkeiten und Zukünfte zu erkunden. Die Autor:innen argumentieren, dass Designer:innen nicht nur für die Schaffung von nützlichen oder ästhetischen Objekten verantwortlich sind, sondern auch eine gesellschaftliche Rolle spielen sollten. Sie sollen Visionen entwerfen, die uns dazu anregen, über die Auswirkungen von Technologie, Politik und Umwelt auf unser Leben nachzudenken.
Zentrale Ideen: Spekulatives Design und Design-Fiktion Das Herzstück des Buches ist die Idee des spekulativen Designs und der Design-Fiktion. Spekulatives Design ist eine Methode, bei der hypothetische Szenarien entworfen werden, die ungewöhnliche oder provokative Fragen aufwerfen. Diese Szenarien müssen nicht realistisch oder umsetzbar sein – ihr Ziel ist es, die Grenzen des Vorstellbaren zu erweitern und neue Denkräume zu öffnen. Ein Beispiel dafür ist die Frage: „Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz nicht nur unsere Geräte steuert, sondern auch unsere Lebensentscheidungen beeinflusst?“ Solche Fragen sollen dazu anregen, über die ethischen und sozialen Implikationen von Technologie nachzudenken.
Design-Fiktionen sind eine spezielle Form des spekulativen Designs, bei der fiktive Objekte, Systeme oder Welten entworfen werden, die mögliche Zukünfte darstellen. Diese Fiktionen dienen als Diskussionsgrundlage und helfen uns, über die Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen nachzudenken. Dunne und Raby betonen, dass Design-Fiktionen nicht als Vorhersagen oder Lösungen zu verstehen sind, sondern als Werkzeuge, um neue Perspektiven zu eröffnen.
Gesellschaftliche Verantwortung: Design als politisches Werkzeug Ein zentrales Anliegen des Buches ist die Betonung der gesellschaftlichen Verantwortung von Design. Dunne und Raby argumentieren, dass Design immer auch politisch ist, da es die Art und Weise beeinflusst, wie wir leben, denken und handeln. Wenn Designer:innen sich nur auf marktgerechte Lösungen konzentrieren, bleiben wichtige ethische und soziale Fragen oft unbeachtet. Spekulatives Design hingegen zeigt, dass Design eine Kraft sein kann, die gesellschaftliche Veränderungen anstößt und uns dazu anregt, über unsere Werte und Prioritäten nachzudenken.
Ein Beispiel aus dem Buch ist das Szenario „Foragers“, bei dem Menschen mit speziellen Apparaten ausgestattet werden, die es ihnen ermöglichen, sonst unverdauliche Pflanzen zu essen. Dieses Szenario wirft Fragen über die Zukunft der Ernährung in einer Welt auf, die von Klimawandel und Ressourcenknappheit geprägt ist. Die eigentliche Botschaft liegt jedoch nicht in der technischen Machbarkeit, sondern darin, wie wir heute mit Ressourcen umgehen und welche Konsequenzen unser Handeln für künftige Generationen haben könnte.
Kulturelle und philosophische Bezüge Dunne und Raby beziehen sich in ihrem Werk auf eine Vielzahl von kulturellen und philosophischen Quellen, um ihre Ideen zu untermauern. Sie lassen sich von Science-Fiction-Literatur inspirieren, die oft futuristische Gesellschaftsmodelle entwirft und die Grenzen des Vorstellbaren verschiebt. Philosophen wie Michel Foucault und Bruno Latour dienen ihnen als wichtige Bezugspunkte, um die Zusammenhänge zwischen Wissen, Macht und Gestaltung zu verstehen. Diese interdisziplinäre Herangehensweise zeigt, dass Design nicht isoliert existiert, sondern von kulturellen, ethischen und politischen Überlegungen durchdrungen ist. Beispiele aus dem Buch: Provokative Szenarien
Das Buch ist reich an Beispielen, die das Potenzial des spekulativen Designs verdeutlichen. Ein bekanntes Projekt von Dunne und Raby sind Prototypen, die zeigen, wie sich Lebewesen durch neue Technologien verändern könnten. In einem Entwurf werden künstlich erschaffene Tiere vorgestellt, die spezielle Aufgaben im Dienste des Menschen erfüllen sollen – zum Beispiel als medizinische Helfer oder militärische Einheiten. Diese Ideen werfen sofort ethische Fragen auf: Wie sehr dürfen wir in natürliche Prozesse eingreifen? Und was bedeutet das für unser Verständnis von Tierwohl oder Artenvielfalt?
Ein weiteres Beispiel ist das Projekt „United Micro Kingdoms“, in dem Großbritannien in vier kleine „Mikroreiche“ aufgeteilt wird, die jeweils ganz eigene Regeln, Technologien und Lebensweisen haben. Dieser spielerische Ansatz zeigt, wie unterschiedlich sich eine Gesellschaft entwickeln könnte, wenn bestimmte Ideologien oder Technologien in den Vordergrund rücken. Solche Szenarien eröffnen neue Blickwinkel auf Themen wie ökologische Nachhaltigkeit, politische Systeme oder wirtschaftliche Strukturen.
Wirkung und Ausblick: Design als Katalysator für gesellschaftliche Diskussionen Dunne und Raby betonen, dass spekulatives Design nicht nur für Designer:innen relevant ist, sondern auch für ein breiteres Publikum. Indem sie mögliche Zukünfte in Szene setzen, können Diskussionen angestoßen werden, die sonst kaum stattfinden würden. Design wird so zu einem Werkzeug, das uns hilft, auf gesellschaftliche Veränderungen vorbereitet zu sein oder sie sogar mitzugestalten. Die Autor:innen machen deutlich, dass wir in einer Welt leben, in der die Folgen von Technologie und Politik uns alle betreffen – und dass wir deshalb lernen müssen, uns spekulative und vielleicht auch utopische Fragen zu stellen.
Fazit: Design als soziales Träumen „Speculative Everything“ ist ein Plädoyer dafür, Design als eine Form des sozialen Träumens zu verstehen, das uns dazu anregt, über die Zukunft nachzudenken und neue Möglichkeiten zu erkunden. Dunne und Raby zeigen, dass Design nicht nur ein praktisches Handwerk ist, sondern auch eine kreative und politische Kraft, die uns dabei helfen kann, bessere Zukünfte zu entwerfen. Das Buch ist eine Einladung, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und Design als Werkzeug für gesellschaftliche Veränderungen zu nutzen.
QUELLE / ISBN - 978-0262019842
--> Deutsche Nationalbibliothek--> WorldCat
--> Open Libary